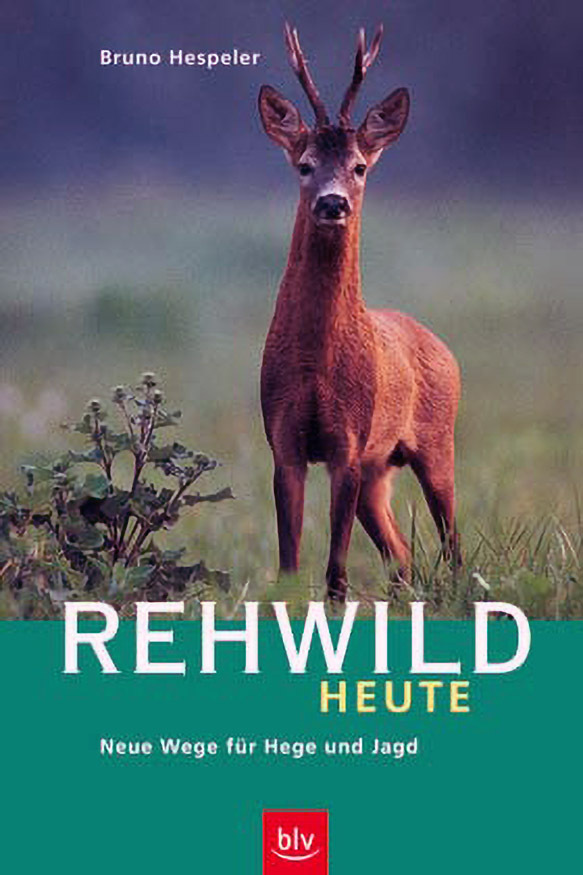Das Reh ist ausgesprochen anpassungsfähig. Wir finden es nicht nur vom Tiefland bis ins Gebirge, sondern selbst am Friedhof der Großstadt. Dies ist für ein Säugetier dieser Größe höchst bemerkenswert.

Im waldarmen Flachland wie hier im Machland im unteren Mühlviertel lebt der Kulturfolger Reh ganzjährig in "Sprüngen". Wir nennen diese geselligen Rehe der offenen Kulturlandschaft "Feldrehe".

Wo es Wald gibt, ist das Reh von Frühling bis Herbst ein ausgeprägter Einzelgänger. Den Winter verbringt es hier in losen Sprüngen von mehreren Tieren.

Das Reh hat eine "Schlüpferfigur" mit niedrigen Schultern und hohem "Hintern" und ist damit an ein Leben am Waldrand angepasst. Dort findet dieser wählerische Pflanzenfresser auf engstem Raum Äsung und Deckung.

Als klassischer Waldrandbewohner erreicht das Reh in der reich gegliederten Kulturlandschaft höhere Dichten als in geschlossenen Wäldern. Die vielen Grenzlinien zwischen Wäldern/Wiesen/Äckern sagen ihm sehr zu.

Von Oktober bis Mai trägt das Reh eine dunkle, langhaarige Winterdecke. Der auffällige weiße Spiegel kann aktiv gesträubt werden und dient als Signal für Artgenossen. Geißen haben zudem ein schwanzartige Schürze.

Sehr selten gibt es auch anders gefärbte Rehe, nämlich weiße oder weiß-braun gezeichnetet Exemplare. In manchen Regionen Europas kommen auch ab und zu schwarze Rehe vor.

Zwischen Mai und Juli (Böcke früher, führende Geißen später) wechseln Rehe vom warmen Winterhaar ins kurze Sommerhaar. Damit ist auch ein Farbwechsel von grau nach rotbraun verbunden. In der Übergangszeit sehen sie recht struppig aus.

Rehe vernehmen dank großer, gut ausrichtbarer Lauscher sehr gut. Die große Nasenschleimhaut verleiht ihnen einen guten Geruchssinn. Die seitlichen Lichter ermöglichen ein gutes Erkennen von Bewegungen.

Rehe erreichen bei ihrer kurzen Flucht in die nächste Deckung hohe Geschwindigkeiten, sind aber keine ausdauernden Läufer. Wie fast alle Wildtiere sind sie auch gute Schwimmer und überqueren sogar mitunter die Donau.

Böcke werfen alljährlich im Herbst das Geweih ab. Es wird gleich im Anschluss wieder neu gebildet. Meist ist es im 4. oder 5. Lebensjahr am stärksten. Diese "Abwurfstange" wurde bereits von Eichhörnchen, Mäusen etc. angenagt.

Während dem Wachstum ist das Geweih von einer samtartigen Haut, dem Bast, umgeben. Diese beinhaltet Blutgefäße und versorgt das Geweih mit Mineralstoffen etc.

Im Spätwinter/Frühling ist das Geweih fertig ausgebildet. Die Basthaut ist dann überflüssig und wird an biegsamen jungen Bäumen verfegt. Ab diesem Zeitpunkt kann es im Kampf als Stirnwaffe eingesetzt werden.

Die stammesgeschichtlichen Vorfahren der Rehe verteidigten sich auch mit langen Eckzähnen. Diese wurden im Laufe der Evolution zurückgebildet. Heute kann man nur mehr in Ausnahmefällen kümmerliche Reste als "Grandeln" finden.

Jede Geweihstange kann ein, zwei oder drei Enden haben und wird als Spieß, Gabel oder Sechserstange bezeichnet. Die Böcke werden demnach als Spießer, Gabler oder Sechser(böcke) bezeichnet.

Ausgewachsene Rehböcke sind von März bis Oktober territorial, grenzen also Reviere ab. Bei der Reviermarkierung schlagen sie mit dem Geweih an jungen Bäumen und scharren darunter den Boden auf. Dabei können sie auch den Kampftrieb abreagieren.

Verfegte Bäume lassen sich insgesamt nicht vemeiden. In manchen Fällen macht aber ein Einzelstammschutz wirtschaftlich wichtiger Bäume mit Kunststoffmanschetten Sinn.

Sehr selten können auch Geißen als Folge hormoneller Störungen ein kleines Geweih schieben. Nichtsdestotrotz zieht diese Geiß zwei normale Kitze auf.

Rehböcke markieren ihr Revier auch mit Duftstoffen, die sie durch Reiben ihres Hauptes in Windfanghöhe auf Pflanzen anbringen. Auch zwischen den Schalen der hinteren Läufe befinden sich Duftdrüsen.

Junge Böcke werden von Revierinhabern verjagt und treiben sich im "Niemandsland" zwischen guten Revieren herum. Oft wandern sie kilometerweit ab, ehe sie eine ruhige Ecke finden.

Rehe haben einen relativ kleinen Pansen und müssen daher mehrmals täglich Nahrung aufnehmen. Sie fressen Kräuter, Gräser, Früchte, Pilze, Knospen, Obst etc. und wählen aus dem aktuellen Angebot die nährstoffreichsten Pflanzen aus.

Nach dem Äsen ziehen sie sich zum Nachdrücken an sichere Orte zurück. Man kann beobachten, wie die Nahrung hochgewürgt, erneut durchgekaut und wieder verschluckt wird.

Geißen setzen im Mai meist zwei, selten eines oder drei Kitze. Diese werden trocken geleckt und lernen gleich danach Stehen und Laufen. Trotzdem verbringen sie die ersten Wochen zumeist alleine am Boden liegend.

Der Kontakt zwischen Kitz und Geiß kann jederzeit durch Fiepen hergestellt werden. Mehrmals pro Tag sucht die Rehgeiß ihre Kitze auf, säugt sie mit dem zwischen den Hinterbeinen liegenden Gesäuge und putzt und massiert sie durch Ablecken.

Mit den weißen Flecken auf braunem Grund sind sie im Unterwuchs des Waldes bestens getarnt. Außerdem haben sie noch kaum einen Eigengeruch. Nähert sich trotzdem ein Beutegreifer (z.B. Fuchs), wird dieser von der wachsamen Geiß verjagt.

Bei Gefahr drücken sich Kitze auf den Boden und vertrauen auf ihre Tarnung. Dieses Verhalten ist im Wald sehr effektiv, kann sich aber in Wiesen sehr verhängnisvoll auswirken.

Der Bauer kann die Rehkitze nämlich vom Traktor aus nicht sehen. Damit die Kitze nicht vom Mähwerk zerstückelt werden, suchen Jäger direkt vor dem Mähen die Wiese mit Jagdhunden ab.

Manche Jäger markieren gefundene Rehkitze mit vom Landesjagdverband herausgegebenen Lauschermarken. Durch Meldung der Lauschermarken-Nummern erlegter Rehe können Fragestellungen wie das Abwanderungsverhalten erforscht werden.

In der Wiese angetroffene Rehkitze werden in den sicheren Wald gebracht. Damit die Jungtiere möglichst wenig menschliche Witterung annehmen, werden sie unter Zuhilfenahme eines Grasbüschels getragen.

Oft werden zusätzlich auch schon am Tag vor dem Mähen Rehscheuchen aus raschelnden Säcken in der Wiese platziert. Auch die vom Jäger und seinem Hund hinterlassene Witterung wirkt aubschreckend auf das Rehwild.

In diesem Fall wurde das Kitz mit einem Käfig abgedeckt und dieser markiert, um das Kitz erst kurz vor der Mahd in den Wald zu bringen oder um in diesem Wiesenbereich auf die Mahd zu verzichten.

Zur Kitzsuche können auch tragbare Wildretter (z.B. der Fa. isa Industrieelektronik GmbH) eigesetzt werden. Diese bestehen aus auf einer Teleskopstange angebrachten Infrarotsensoren, die in einer 6 m breiten Schneise warme Rehkitze in der kalten Wiese aufspüren und dann einen Alarm auslösen können.

In Zukunft können zur Kitzsuche möglicherweise auch verschiedene Sensoren und Kameras auf Computer- und GPS-gesteuerten "fliegenden Plattformen" eingesetzt werden. Diese Bild zeigt einen Prototyp bei Testflügen (Projektkonsortium Fa. ISA / DLR / TU München / Fa. CLAAS).

Rehe haben eine relativ hohe Fortpflanzungsrate. Reguliert werden Bestände durch Witterungseinflüsse, Krankheiten, Beutegreifer und insbesondere die Jagd. Dieses Kitz starb infolge kalter, nasser Witterung.

Unter den Beutegreifern stellt vor allem der Fuchs eine Gefahr dar. Er erbeutet fast ausschließlich Kitze. Nur in absoluten Ausnahmefällen können Füchse im Winter bei vorteilhafter Schneelage und gemeinschaftlicher Jagd sogar erwachsene Rehe reißen.

Wo vorhanden, ist der natürliche Hauptfeind des Rehs aber der Luchs. Diese hochbeinige Katze ist ein Ansitz- und Schleichjäger, der seine Beute nach einem Sprung oder kurzen Sprint durch einen Drosselbiss tötet.

Rehe können in seltenen Fällen ein Alter von 10-12 Jahren erreichen. Der körperliche Verfall beginnt aber schon mit rund 6 Jahren. Dieser alte, zurückgesetzte Bock hat einen eingerissenen Lauscher und einen durchhängenden Rücken.

Um eine natürliche Verjüngung unserer Wälder zu gewährleisten, müssen Rehe (und Rotwild) reguliert werden. Dies geschieht im Normalfall durch Abschuss vom Hochstand aus.

Die Anzahl der zu erlegenden Rehe richtet sich nach der Verbissbelastung und wird dem Jäger vorgeschrieben. Nach dem Vorbild der Natur (Beutegreifer, Krankheiten) erfolgt der Eingriff vorwiegend in die Jugend- und Altersklasse.

Durch die Bejagung senkt der Jäger nicht nur die Rehdichte auf ein für den Lebensraum verträgliches Maß ab, sondern erntet auch ein gesundes und wohlschmeckendes Lebensmittel. Wildbret eignet sich übrigens auch zum Grillen.

Im Frühsommer verhalten sich Rehe eher unauffällig: Die Reviere sind abgesteckt und es werden Kräfte für die Brunft gesammelt. Die hohen Getreidefelder sind dann beliebte Einstände.

Mitte Juli setzt die Brunft der Rehe ein. Böcke finden paarungsbereite Geißen über deren Fährtengeruch. Anschließend wird die Geiß keuchend durch dick und dünn verfolgt. Schließlich kommt der Bock der Geiß näher ....

... und folgt ihr dichtauf. Am Schluss bewegen sich die beiden oft auf kreisförmigen Bahnen oder Achterschleifen. Mitunter kann mann auch beobachten, dass der Bock am Feuchtblatt windet oder leckt.

Schließlich kommt es zum Aufreiten des Bockes und zum Beschlag. Manchmal finden zwei oder mehrere Beschläge statt, zwischen denen sich die Rehe niedertun, ausruhen, belecken, ...

Das bei der Brunft in den Boden getrampelte Gras düngt diesen und führt im Folgejahr zu einem verstärkten Wachstum. Diese dunkelgrünen Ringe wurden früher mangels naturwissenschaftlicher Erklärung "Hexenringe" genannt.

Die Ausbildung der relativ kleinen Rehkitze dauert nicht bis in den nächsten Mai. Daher kommt es nach der Befruchtung der Eizelle zu einer mehrmonatigen Keimruhe. Der Keim entwickelt sich erst Ende Dezember wieder weiter.

Wenn im Herbst die Tage wieder kürzer werden, ist die Gefahr eines Verkehrsunfalls mit Rehen - insbesondere bei Walddurchfahrten - besonders groß. Aufmerksame Autofahrer sehen das Wild, ...

... bevor es die Fahrbahn kreuzt. Kollisionen mit Wildtieren verursachen alljährlich hohen Sach- und Personenschaden.

Wie folgenreich Kollisionen mit Rehen ausgehen könn(t)en, zeigt dieser Fall: Ein Rehbock durchschlug die Windschutzscheibe dieses Fahrzeuges ...

... und kam am (zum Glück unbesetzten) Beifahrersitz zu liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Im Interesse von Mensch und Wild sollte das Verkehrsschild "ACHTUNG WILDWECHSEL" deshalb ernst genommen werden.

Jäger kennen gefährliche Straßenabschnitte besonders gut und leisten ihren Beitrag, um Unfälle mit Wild zu verringern. In diesem Fall wurde ein selbst gebastelter Reflektor an einem Straßenpflock angebracht, der Rehe vor Autos warnen soll.

Hier wurde ein Wildwarnreflektor mit einem "Duftzaun" kombiniert. Der Reflektor lenkt das Scheinwerferlicht in Richtung der Wildtiere ab. Aus dem Schaum entweichende Duftstoffe wirken zusätzlich abstoßend auf Wildtiere.

An vielbefahrenen Straßen werden auch oft permanente Wildzäune inklusive "Viehgitter" (Überquerungsschutz aus Grube mit darüber liegendem Gitter) an den Zufahrten errichtet.

Weidezäune hingegen können für Rehe zu Fallen werden. Oft kommt es vor, dass sich Böcke mit dem Geweih darin verfangen und verenden, wenn sie nicht - wie in diesem Fall - befreit werden.

Rehe bereiten sich schon im Herbst auf den langen, kalten Winter vor, indem sie sich eine Feistschicht anfressen. Eicheln (und Bucheckern) sind hierfür ein besonders beliebtes, natürliches Kraftfutter.

Auch auf landwirtschaftlichen Flächen (Raps, Wintergetreide) finden Rehe Pflanzen, die sie gerne äsen.

Rehe beeinflussen als Pflanzenfresser die Vegetation. Bei zu hoher Dichte verursachen sie Schäden durch Fressen von Baumkeimlingen und Verbeißen von Wipfeltrieben junger Bäume.

In naturnahen Mischwäldern mit guter Naturverjüngung können Rehe auf Grund der großen Zahl nachwachsender Bäume auch viele Triebe und Knospen fressen, ohne einen Schaden anzurichten.

Im Vergleich zur Naturverjüngung stehen in vom Menschen angepflanzten Kulturen die Bäume in sehr geringer Dichte. Selbst wenig Rehe können hier durch Verbiss der Wipfeltriebe leicht Schäden verursachen.

Rehe sind eigentlich an den Winter bestens angepasst: Sie haben eine dicke Winterdecke, bewegen sich kaum und drosseln den Stoffwechsel auf ein Minimum. Sie sind also echte Energiesparmeister.

Das Betreiben von Rehfütterungen wird daher zunehmend kritischer gesehen. Einseitige Futtermittelgaben können nämlich Verdauungsprobleme verursachen. Und nicht selten kommt es im Umkreis zur Konzentration von Rehen und damit zu Verbisschäden.

Wenn man Futterstellen errichtet, sollte dies gleichmäßig verteilt in wenig verbissgefährdeten Revierteilen erfolgen. Die Kombination von hochwertigem Heu, Saftfutter (Apfeltrester) und etwas Kraftfutter (Hafer) ist für Rehe meist gut verträglich.

Beim Reh besonders beliebte Wirtschaftsbäume wie die Tanne kann man schützen, indem man den Wipfel mit einem bitter schmeckenden "Verbissschutzmittel" einstreicht. Manchmal werden auch Schafwolle, Menschenhaare, ... aufgebracht.

Die etwas höher an der Rückseite des Laufes befindlichen Afterklauen drücken sich nur in weichem Untergrund ab.

Flüchtige Rehe hingegen hinterlassen unterschiedlich aussehende "Vierer-Abdrücke" mit größeren Abständen dazwischen.

Bevor sich Rehe niedertun, schlagen sie mit den Vorderläufen Schnee und/oder Laub beiseite. Diese Betten sind häufig zu beobachtende Spuren. In Wiesen erkennt man Betten am niedergedrückten Gras.

Am liebsten ruhen Rehe an Stellen, an denen sie einen guten Überblick haben, selbst aber schlecht gesehen werden. Dies ist z.B. an Waldrändern und auf Kuppen der Fall.

Die Losung der Rehe erinnert im Winter an Kaffeebohnen. Im Sommer besteht sie eher aus unregelmäßigen Klumpen.

Wo attraktive Flächen für das Reh rar sind, können Jäger durch die Anlage von Wildwiesen, Wildäckern, Ackerrandstreifen etc. das Reh und andere Wildarten fördern oder zumindest deren Sichtbarkeit erhöhen.

Die Anlage ökologisch wertvoller Ackerrandstreifen ("Blühstreifen") wird von öffentlicher Hand gefördert. Bei dieser Art der Hege gäbe es noch viel Potenzial.

Rehe sind jedenfalls faszinierende Wildtiere, die man auf Grund ihrer Anpassungsfähigkeit fast überall antreffen kann. Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, kann sie oft beobachten und ihre Spuren finden.